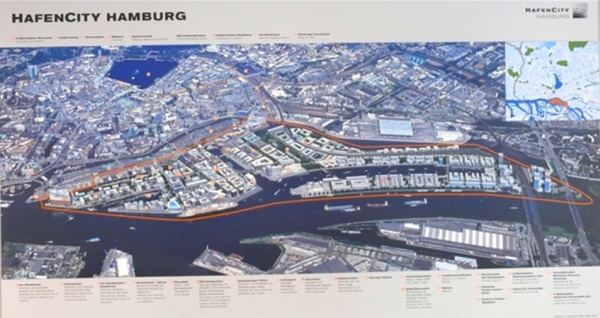Der Hamburger Hafen,
gestern, heute und morgen

Luftansicht des Hamburger Hafens (Quelle:
http://de.wikipedia.org) |
Hört man den Namen „Hamburg“, so ist eines der ersten Dinge, die man damit
in Verbindung bringt, sicherlich der Hamburger Hafen. Dieser vereinigt mit
seiner Lage die Merkmale von See-, Binnen- und Tidehafen. Er ist
Deutschlands größter und zugleich Europas drittgrößter Hafen. Heutzutage
umfasst er ein Gebiet der Fläche von 7.399 Hektar und hat einen
Gesamtumschlag von 106,3 Millionen Tonnen sowie einen Containerumschlag
von 6,1 Millionen TEU. Die Abkürzung TEU steht für „Twenty feet
Equivalent Unit“, zu deutsch „20 Fuß-Standardcontainer“, einer Norm für
die beim Seehandel eingesetzten Container. Dies macht deutlich, dass der
Hafen für den Wohlstand und das Wachstum von Hamburg schon immer sehr
wichtig war.
|
Lage

Hauptmärkte für den im Hamburger Hafen
abgewickelten Containerverkehr: Schwerpunkte im In- und Export in Europa
(Quelle:
http://www.zukunftelbe.de/) |
Hamburgs Hafen ist der östlichste der Nordsee und liegt im Zentrum des
Schiffsverkehrs von Osten nach Westen zwischen der Ost- und Nordsee sowie
des Atlantiks. Somit ist er eine der wichtigsten Warenumschlagstellen
zwischen Ost-, Mittel- und Westeuropa. Seine Lage an der Elbe, ca. 110 km
entfernt von deren Mündung in die Nordsee sind die Ursache dafür, dass man
ihn als Tide- und Binnenhafen sehen kann. Da auch große Containerschiffe
den Hafen dank dem ständigen Einsatz von Baggerschiffen, welche eine
Fahrwassertiefe von 13 Metern gewährleisten, bei Flut anlaufen können,
zählt Hamburgs Hafen aber auch zu den Seehäfen. Die Tatsache, dass der
Hamburger Hafen zum Meer hin offen ist und die Gezeiten daher eine Rolle
spielen, machen ihn zum Tidehafen, seine Lage im Landesinneren an der Elbe
und seine gute Anbindung an Hamburgs Infrastruktur wie z. B. die
Hafenbahn, Autobahnen und restliche Schienennetze, welche eine optimale
Anbindung an internationale Verkehrswege garantieren, machen ihn
gleichzeitig zum Binnenhafen. Diese Lage hat den Vorteil, dass die von den
Schiffen transportierten Waren automatisch sehr weit ins Landesinnere
hinein gelangen, was nicht nur deutlich billiger als der Transport per LKW
oder Zug ist (zum Vergleich: Ein mit 4000 TEU-Containern beladenes Schiff
fasst 3.200 LKW- oder 80 Zugladungen), sondern auch die Infrastruktur
entlastet und zugleich die Umwelt mehr schont.
|
Geschichte des Hafens
Ein
kleiner Hafen wurde in Hamburg das erste mal im neunten Jahrhundert erwähnt, zu
dieser Zeit war Hamburg im Gegensatz zu heute noch eine 200-Einwohner-Stadt;
bereits im Jahre 937 verlieh der damalige Erzbischof Adaldag, dessen
Erzbischofssitz das Gebiet Bremen-Hamburg war, der Stadt das Marktrecht.
Zirka 250 Jahre später, nämlich am 7. Mai 1189 bekam Hamburg weitere Privilegien
von Kaiser Friedrich Barbarossa verliehen, welche den Hamburgern die zollfreie
Schifffahrt auf der Unterelbe vom Meer aus bis in die Stadt, sowie die Fischerei
zwei Meilen weit zu beiden Seiten Hamburgs gewährten. Dieses Datum gilt als
offizielle Geburtsstunde des Hamburger Hafens. Auch wenn es bereits 1188
Hafenanlagen am Nikolaifleet gab, zählt das Reichenstraßenfleet, welches 1866
zugeschüttet wurde, als erster Hafen nach der Verleihung der Privilegien durch
den Kaiser.

Das Elbtal im 12. Jahrhundert,
der Strom wurde noch nicht reguliert
(Quelle:
http://www.rettet-die-elbe.de)
Als Fleete bezeichnet man künstlich ausgebaute,
in Küstennähe liegende Kanäle, welche für den Warenverkehr genutzt wurden. Ihr
Wasserstand wird durch die Tide geregelt. Hamburgs Beitritt zur Hanse im Jahr
1321 sorgte für einen Aufschwung des Außenhandels. 1664 erlangte Altona, welches
damals noch dänisch war, das Stadtrecht, was dazu führte, dass der Hamburger
Hafen starke Konkurrenz bekam, welche durch die im Jahre 1806 von Napoleon
verhängte Kontinentalsperre gegen England noch verstärkt wurde, weil Firmen, die
bisher in Hamburg ansässig waren, nach Altona abwanderten. Die Verleihung von
Stadtrechten war in der damaligen Zeit etwas besonderes, mit diesen Rechten
wurde eine Stadt nämlich autonom, d.h. sie durfte sich selbst verwalten.

Das Elbtal um 1600, der Strom
wurde mittlerweile reguliert. Gorieswerthere zerfiel nach einer Sturmflut in
mehrere kleine Inseln.
(Quelle:
http://www.rettet-die-elbe.de)
Ab 1807
galt die Kontinentalsperre jedoch auch für Altona, welches dadurch ab diesem
Zeitpunkt ebenfalls in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet. Obwohl Amerika
bereits 1492 von Columbus entdeckt wurde, begann Hamburg den Handel mit diesen
Land erst ab dem Jahr 1782. In den 80er Jahren des 18. Jahrhunderts wuchs die
Anzahl der beheimateten Schiffe des Hafens von 150 (1788) auf 280 (1799), dies
ist für die damalige Zeit trotz einer Zeitspanne von 11 Jahren ein großes
Wachstum; ca. 50 Jahre später, die von Napoleon verhängte Kontinentalsperre war
bereits wieder aufgehoben, war der Hamburger Hafen bereits auf jedem Weltmeer
mit Schiffen vertreten.
1862 wurde
beschlossen den Hafen, welcher mittlerweile nicht mehr groß und modern genug
war, im Zuge von Ausbauarbeiten zu einem Tidehafen umzubauen. Im Gegensatz zu
einem Dockhafen, welcher ebenfalls zur Auswahl stand, können Tidehäfen zu jeder
Zeit von Schiffen angefahren werden (abgesehen von denjenigen Schiffen, welche
einen großen Tiefgang haben), während ein Dockhafen durch das Vorhandensein von
Schleusen in der Hafeneinfahrt nicht zu jeder beliebigen Zeit angefahren werden
kann. Nachdem Deutschland zwischen 1870 und 1871 vereinigt wurde, drängte Otto
von Bismarck die Stadt dazu, sich dem deutschen Zollverein anzuschließen. Im
Zuge dieser Entscheidung wurde ein Teil des Hafens zum Freihafen erklärt, auf
dem die Speicherstadt, welche der bis heute weltgrößte zusammenhängende
Lagerhauskomplex der Welt ist, errichtet wurde. Zwar wurde die Speicherstadt am
1.1.2003 im Zug des Projekts HafenCity größtenteils aus dem Gebiet des
Freihafens herausgenommen, jedoch war es den Unternehmen bis dahin möglich, ihre
Ware dort zollfrei zu lagern, umzuschlagen und bei Bedarf zu veredeln.
Man könnte
vermuten, dass dies für die Unternehmer ein Rückschritt war. Jedoch werden
heute, in Zeiten der Globalisierung, durch Produktionsweisen wie just-in-time
sowie just-in-sequence, bei denen die Waren (z.B. vormontierte Bauteile für ein
Auto) praktisch „direkt ans Fließband“ geliefert werden, nur noch in sehr
begrenztem Umfang Lagerplätze benötigt. Somit sind die Teile der Speicherstadt,
welche aus dem Gebiet des Freihafens gestrichen wurden also für die Unternehmer
entbehrlich.
Hamburgs
Hafen war ab dem Jahr 1913 für einige Zeit der wichtigste Hafen Europas, wurde
aber im Zweiten Weltkrieg zu 80% zerstört. Da der Hafen aber schon immer für die
Stadt sehr wichtig war, gingen die Wiederaufbauarbeiten nach dem Zweiten
Weltkrieg schnell voran, sodass er bereits 1960 größtenteils wieder hergestellt
war. Schon ein Jahr nachdem der Hafen wieder aufgebaut war, gab es weitere
Ausbaupläne für den Hafen, welche vorsahen, ihn in Richtung Moorburg und
Altenwerder, wo sich heute das modernste Containerterminal der Welt befindet, zu
erweitern. Der Handel mit Hilfe von Containern, welche heute genormt sind (es
gibt 20-Fuß- und 40-Fuß-Container) begann ab zirka 1967, zu dieser Zeit jedoch
noch mit Containern verschiedenster Maße, was für einen nicht ganz
reibungsfreien Ablauf sorgte.

Das Containerterminal Altenwerder
(Quelle: Fabian Kopp)
Gegenwart und Zukunft des Hamburger
Hafens
1989
feierte der Hafen seinen 800. Geburtstag, dieser wird jährlich mit einem
zweitägigen Fest gefeiert. 2002 wurde, wie schon erwähnt, das modernste
Containerterminal der Welt in Altenwerder, kurz CTA, in Betrieb genommen. Seit
dem 01.10.2005 ist die Hamburg Port Authority privatisiert und kümmert sich um
den Strom- und Hafenbau, sowie die Planung der Logistik, vormals waren hierfür
verschiedene Einrichtungen zuständig. Die Geschäftsführung ist in zwei Bereiche
unterteilt. Jens Meier ist Geschäftsführer des kaufmännischen Bereichs, Dr.-Ing.
Hans Peter Dücker leitet den technischen Teil der Geschäftsführung. Finanziert
wird die Arbeit der Hamburg Port Authority durch ein eigenes Budget, welches
sich aus den Einnahmen, die durch Vermietung von Hafenflächen und anderen Dingen
entstehen zusammensetzt. Zu diesen Einnahmen kommen noch öffentliche
Investitionsmittel hinzu, welche für den Ausbau der Infrastruktur des
Hafengeländes vorgesehen sind. Für die Zukunft ist noch Erweiterungsfläche für
den Hafen vorhanden, welche bei voller Ausnutzung einen Umschlag von bis zu 18
Millionen TEU, also dem Dreifachen des heutigen Umschlags, ermöglichen würde.
Ein
Bürgerbeschluss stimmte 1997 für den Bau der HafenCity, die ein neuer Stadtteil
Hamburgs ist, welcher sich aus den Gebieten Altstadt, Klostertor und
Rothenburgsort zusammensetzt. Im September 2007 wurde der erste Spatenstich für
den Bau des Herzens der HafenCity, das Überseequartier, begonnen, dies soll bis
zum Jahr 2010 fertig gestellt sein. Seit Ende 2007 sind erste Wohngebiete fertig
gestellt, in denen bereits ca. 800 Menschen leben. Für das Jahr 2008 und die
weitere Zukunft sind der Bau von kulturellen Einrichtungen, wie zum Beispiel
zwei Konzertsäle, einem Fünf-Sterne-Hotel und weiteren Wohngebieten sowie
Bürogebäude geplant.
Nach dem
Ausbau der HafenCity hat dieser Stadtteil nicht mehr direkt etwas mit dem Hafen
zu tun. Einerseits könnte man ihn jedoch als weichen Standortfaktor für die im
Hafen angesiedelten Unternehmen und Betriebe ansehen, da dieser Teil der Stadt
durch das kulturelle Angebot und die Nähe zum Arbeitsplatz nämlich interessant
für Arbeitnehmer wird, andererseits senken die hohen Miet- und Kaufpreise der
Wohnungen jedoch die Attraktivität dieses Stadtteils als Wohnort wieder.
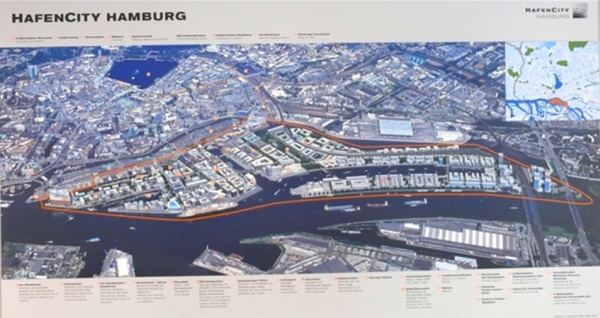
Aussehen der HafenCity nach der
Fertigstellung (Quelle: Fabian Kopp)

Planungsmodell der HafenCity
(Quelle:
http://de.wikipedia.org/)
Der Hafen als
Arbeitgeber
Aufgrund
seiner Größe ist der Hafen einer der wichtigsten Arbeitgeber in Hamburg, 154.000
Arbeitsplätze sind direkt oder auch indirekt von ihm abhängig. Indirekt
abhängige Arbeitsplätze sind diejenigen, welche in Unternehmen angesiedelt sind,
die Beziehungen zu Unternehmen haben, welche mit der Hafenindustrie und
Hafenwirtschaft zu tun haben. Zu den direkt abhängigen Arbeitsplätzen gehören
zum Beispiel diejenigen der Seefahrtbetriebe, der Logistik-Unternehmen sowie der
Verwaltungen für Hafenbelange wie der Hamburg Port Authority.
Links
Förderkreis "Rettet die Elbe"
Hafen
Hamburg Marketing e.V.
Hamburg Port
Authority
Wikipedia-Artikel über den Hamburger Hafen
Mediaservice zur FIFA WM 2006 in Hamburg
Initiative "Zukunft Elbe"
tabellarische
Übersicht über die Geschichte Bremens